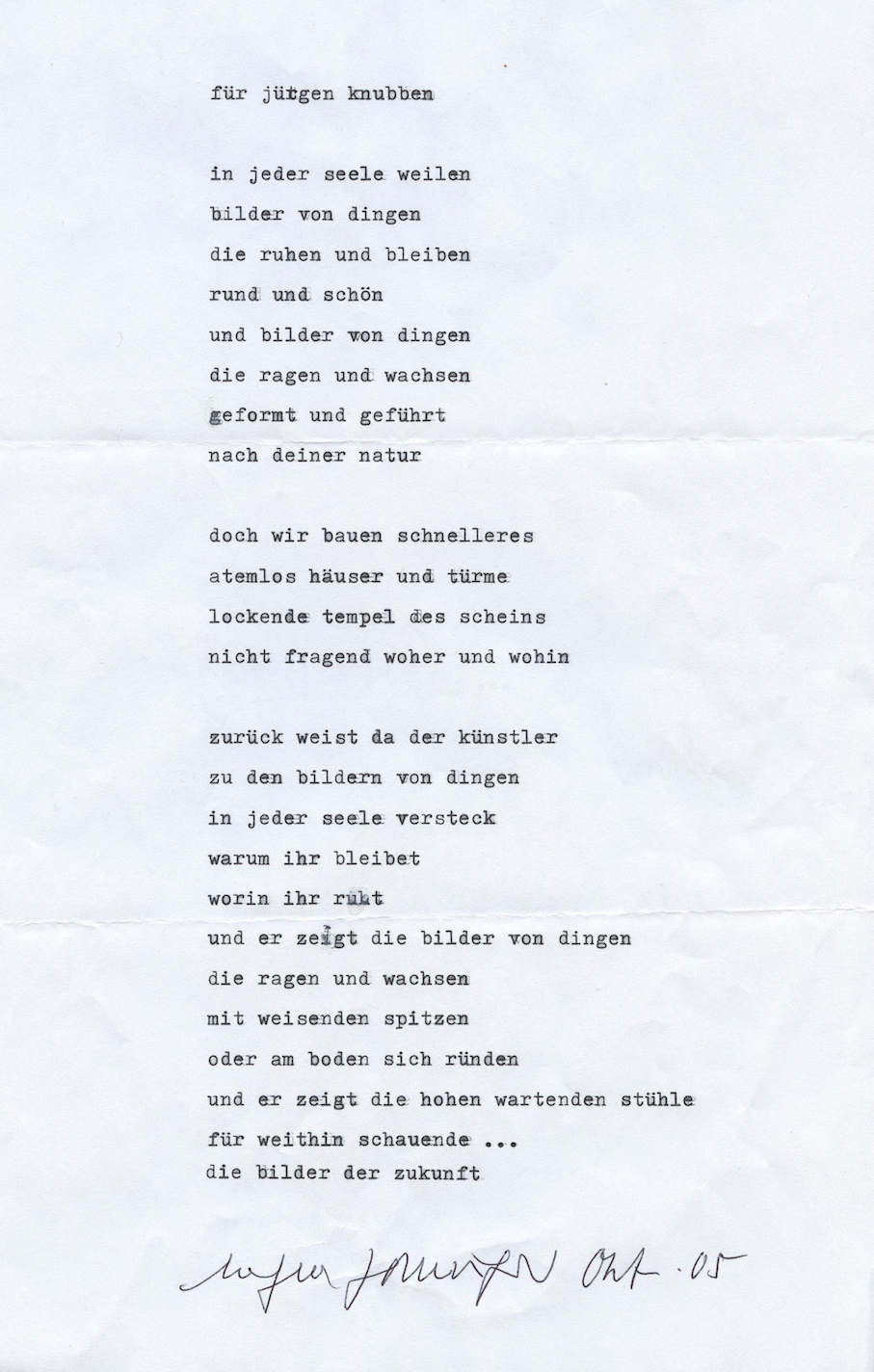Eine „bunte Königin“ habe er gefunden, notierte am 5. Dezember 1912 Ludwig Borchardt in seinen Aufzeichnungen. Der Berliner Architekt und Archäologe war bei einer Grabungskampagne im mittelägyptischen Tell-el-Amarna auf die Werkstatt des Bildhauers Thutmosis gestoßen und konnte eine ganze Reihe von Skulpturen und Masken bergen. Niemand hätte damals zu prophezeien gewagt, dass besagte „bunte Königin“, später identifiziert als Nofretete, die Hauptgemahlin des Pharao Echnaton (Regierungszeit 1353 bis 1336 v. Chr.), einmal zur weltweit beachteten Ikone stilisiert werden würde, zum überzeitlichen Symbol weiblicher Schönheit. Dietrich Wildung, lange Jahre Direktor des Äyptischen Museums Berlin, dessen Hauptattraktion die antike Herrscherin ist, sprach von ihr gar als „Botschafterin zwischen Orient und Okzident“.
Die Erscheinung der Portraitbüste ist in der Tat imposant. Thutmosis hat aus Kalkstein, Stuck und Farbe ein ideales Frauenbildnis geschaffen: makellos symmetrisches Gesicht, langer Hals, perfektes Make-up. Das Dekolletee schmückt eine mehrreihige Kette, das edle Haupt eine langgezogene blaue Kronenhaube mit der Uräusschlange. Die Pharaonengattin trug ihren Namen (übersetzt: „Die Schöne ist gekommen“) nicht umsonst.
Die eleganten Linien und Proportionen von Krone, Frontalansicht bzw. Profil, Hals und Schulter der Nofretete greift der Bildhauer Jürgen Knubben auf und reduziert sie auf einen geometrisch konstruierten Körper aus Dreiecken. Stein und Gips ersetzt er durch das zeitgenössische Material Stahl, die subtil leuchtende Farbigkeit des antiken Vorbildes durch eine rostige Patina. Er gibt der Plastik den Titel „Tête“ – doch das Verblüffende ist: der Betrachter kann die ägyptische Königin auch nach dieser Radikalkur fast auf Anhieb identifizieren. Alle individuellen Merkmale sind ausgelöscht, allein die Form bleibt übrig, vor allem die der charakteristischen Kopfbedeckung. Das genügt. Nofretetes Gestalt hat sich unserem kulturellen Gedächtnis eingeprägt.
Des Künstlers Interesse gilt seit langem archaischen Zeichen: Leitern, Räder, Boote, Türme, Treppen oder Pyramiden sind Geräte und Bauwerke, die zugleich mythische, oft ins Transzendente weisende Vorstellungen repräsentieren. Er entschlackt all diese Motive von jeglichem, aus seiner Sicht überflüssigen, formalen Ballast und überführt sie in konsequent konkrete Gebilde, objektiviert sie damit, ohne sie ihrer Symbolhaftigkeit zu berauben.
Im Falle der Nofretete ist Knubbens Strategie der Transformation noch raffinierter. Wie bereits in seinem „Venus“-Projekt, das aus Botticellis Gemälde nur die Konturen der Göttin extrahiert und in eine abstrahierte Skulptur überführt, entzieht er ein zur Schau gestelltes, millionenfach betrachtetes und vielfach abgebildetes Objekt quasi der öffentlichen Zudringlichkeit. Die Schöne vom Nil darf jetzt einmal anonym sein. Und wenn Knubben seine Version vervielfältigt und dutzendweise auf den Sockel stellt, greift er zum einen die Arbeitsweise des Thutmosis auf, der in seinem Bildhaueratelier vor bald 3500 Jahren seriell Statuen der Königsfamilie für Tempel und Paläste fertigte. Zum anderen bedient er sich einer Taktik, die spätestens seit Andy Warhol zum Repertoire der Kunst gehört: die Multiplizierung populärer Bildgegenstände – seien es Prominente, seien es profane Utensilien oder auch Leonardos „Abendmahl“.
Doch wenn Warhol die Mechanismen des Marktes und der Massenmedien für seine Kunst nutzte, nachahmte und damit die Banalität zur Maxime erhob, geht Jürgen Knubben einen anderen Weg. Er befreit ein Idol aus dem musealen Kontext, der immer auch ein wenig elitär ist, befreit auch die Nofretete vom Zwang ewiger Schönheit – denn das idealisierte Bildnis diente selbstverständlich den Interessen der Herrscherfamilie, (ent)rückte es doch die Königin in übermenschliche und überirdische Sphären.
Den gesichts-losen, schlicht monochromen „Têtes“ haftet zwar immer noch ein wenig die Aura der Unnahbarkeit an. Und doch hat Knubben das Jahrtausende alte Kunstwerk gewissermaßen demokratisiert, die Überhöhung auf fast spielerische Weise aufgelöst. Der gewagte Brückenschlag zwischen dem alten Ägypten und dem zeitgenössischen Europa ist ihm gelungen – mit etwas Subversivität und viel Ironie.
Claudia Knubben, 2011